Dienstbeschädigt im Ersten Weltkrieg, "euthanasiert" im Zweiten Weltkrieg
Karl August H. wurde in Oberensingen geboren
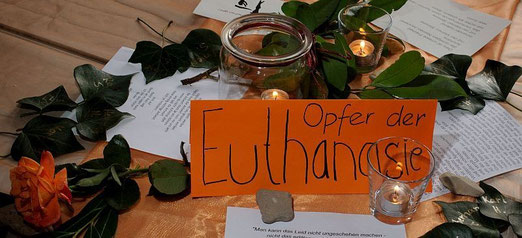
Im Winter 1883
wurde Karl August H. als erstes Kind seiner Eltern August und Luise Rosine H., geborene S., in Oberensingen geboren und evangelisch erzogen. Sein Vater, Bürger und Flaschnermeister von Beruf, war 1883 von Fellbach nach Oberensingen gezogen, um hier mit der Oberensingerin eine Familie zu gründen. (1,12)
Im Jahr 1886
lebte die Familie in Neckartenzlingen, wo der Vater das Bürgerrecht beantragte. Zu dieser Zeit waren die Eheleute „seit einem Jahr hier ansässig“. (12) Karls Bruder Hermann, der 1888 in Neckartenzlingen geboren wurde, heiratete 1912 nach Oberensingen, er fiel 1914 als Reservist in Sedan/ Frankreich. Dessen zweiter Sohn wiederum wurde im Zweiten Weltkrieg vermisst. (1)
Im Jahr 1906
trat Karl H. in Reutlingen als Flaschner in das Geschäft von Julius Dietterlein ein und arbeitete dort bis zum Jahr 1911. Zu dieser Zeit wohnte er in der Reutlinger Albstraße. (5)

Im Oktober 1908
heiratete er in Neckartenzlingen Christiane Pauline M., die aus Grötzingen stammte (1884 bis 1982). Das junge Ehepaar lebte in Reutlingen, jetzt in der Leonhardstraße. 1909 wurde dort der Sohn Karl Gustav, 1911 die Tochter Gertrud, geboren. (8)
Im Jahr 1911
bezog Karl H. mit seiner Familie ein eigenes Gebäude in der Reutlinger Jos-Weiß-Straße. (6) Im selben Jahr eröffneten die Gebrüder Karl und Gustav H. am dortigen Albtorplatz eine Flaschnerei mit Installationsgeschäft. (9) Vermutlich hatte Karl H. schon zu dieser Zeit den Meistertitel im Flaschnerhandwerk erlangt.
Im November 1912
erhielt er das Bürgerrecht. (10)

Im Herbst 1916
überwies die Militärverwaltung den jetzigen Kanonier aufgrund einer Nervenkrankheit in die Heilanstalt Weißenau: „Falls sich die Krankheit des H. auf eine Dienstbeschädigung während des Militärdienstes zurückführen lässe, wird demselben bei seinem Ausscheiden aus dem activen Heere die gesetzliche Militärrente bewilligt werden. Diese wird zum Unterhalt des Kranken zur Verfügung stehen. ...“ (11 Bl.2)
Im April 1917
wurde er aus der Heilanstalt entlassen. Die Lazarett-Abteilung des XIII. K.W.Armeekorps teilte der Ökonomie-Verwaltung in Weißenau mit: „Als Entlassungsanzug kann H. ein Werktagsanzug belassen werden, die übrigen Bekleidungsstücke sind an das Reservelazarett zurückzusenden.“ Kurz zuvor war Karl H. „als 50% erwerbsunfähig erachtet und mit einer Rente von monatlich 22 M(ark) 50 Pf(ennig) aus dem Heeresdienst...“ entlassen worden. Die weitere Fürsorge ging, falls diese Rente nicht ausreichen sollte, auf die Ortsarmenbehörde Reutlingen über. (11 Bl.1)
Im Jahr 1920
ist nur noch Karl H. im Reutlinger Adressbuch zu finden. Der Name seines Bruders Gustav, der mit Karl vor dem Krieg die Flaschnerei geführt hatte, wird hier nicht mehr genannt. Ob er auch, wie der Bruder Hermann, nicht mehr aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, ist nicht bekannt. (13 S. 58)
Im Oktober 1923
wurde Karl H. in die Tübinger Universitätsklinik für Gemüts- und Nervenkrankheiten aufgenommen. Da er dort nicht auf Dauer bleiben, zu Hause „aber einstweilen nicht verpflegt werden“ konnte, wurde die Unterbringung in einer Staatsirrenanstalt notwendig. (11 Bl.3) Ob er sich nun auf Dauer oder nur vorübergehend in der Heilanstalt Weißenau aufhielt, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Seine Frau, die „die verkürzte Kriegsbeschädigtenrente ihres Mannes in Höhe von rund 20 M. monatlich“ erhielt, verpflichtete sich in einer Urkunde, „alle Kosten für die Verpflegung ihres Mannes in der III. Klasse eine der württembergischen Staatsirrenanstalt“ zu bezahlen. (11 Bl.8) In den Reutlinger Adressbüchern von 1925 und 1928 taucht sein Name weiter auf. (14)
Im Jahr 1937
lebte Karl H. in der Heilanstalt Weißenau. Zu dieser Zeit erhielt seine Frau weiter die Militärrente in Höhe von monatlich 182 Reichsmark vom Versorgungsamt Ulm. Davon bestritt sie die Verpflegungskosten für ihren Ehemann von täglich vier Reichsmark. Der inzwischen 28-Jahre alte Sohn Karl hatte 1933 geheiratet und betrieb die Flaschnerei. Er sorgte für den Lebensunterhalt seiner eigenen Familie, für die Mutter und für seine Schwester Gertrud, die selbst ohne eigenes Einkommen war. (11 Bl.11) Gertrud heiratete Anfang 1940 einen Unteroffizier. (8 Bl.209)
Am 22. 08. 1940
wurde Karl H. von der Staatlichen Heil-und Pflegeanstalt Weißenau nach Grafeneck deportiert und dort am selben Tag in der Gaskammer ermordet. (2)


Der 12. 09. 1940
ist sein offizielles Sterbedatum. Lt. einer Mitteilung zum Geburtseintrag soll er in Sonnenstein/ Sachsen gestorben sein. (3) Das offizielle Todesdatum entsprach in den wenigsten Fällen den realen Tatsachen. Um Nachforschungen von Angehörigen zu vermeiden, gehörten systematische Täuschungsmanöver und Verfälschungen von Ort und Zeitpunkt der Ermordungen zum Alltag in den Tötungsanstalten. Nicht nur die Opfer selbst, sondern auch die Erinnerungen an sie, sollten gründlich ausgelöscht werden.
Karl August H. war 56 Jahre alt geworden.
Lt. einer Statistik wurden im Monat September 1940 in Grafeneck mehr als 1.400 Menschen vergast, im Jahr 1940 waren es insgesamt etwa 10.000 Menschen. (4)
Quellen:
- StANT, OFB Nr. 2032
- Gedenkstätte Grafeneck, März 2014
- StANT, Standesamt Sonnenstein, Mitteilung 13. 09. 1940, Nr. 562/ 40
- Hrgb. Klee, E., Dokumente zur Euthanasie, 1985, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ Main, ISBN 978-3-596-24327-3) S. 233
- StART, Adressbuch von 1907
- StART, Eintrag Einwohnermeldekarteikarte
- StART, Einwohnermeldekartei 1933
- StART, Familienregister Band 42
- StART, Gewerbeänderungsregister
- StART, Bürgerliste
- StART, Einzelfallakte der Armenpflege
- KrAES, Bürgerannahmsprotokoll 1884-1913, GemA Neckartenzlingen, NB 261
- StART, Adressbuch von 1920
-
StART, Adressbücher von 1925, 1928
Von den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in die Gaskammern des Zweiten Weltkriegs
Welches Schicksal erlitten psychisch kranke Soldaten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs? Schon kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs reagierte eine Vielzahl der Soldaten auf das Erlebte zum Beispiel auch mit Lähmungen der Extremitäten, sie „zuckten, zitterten, verstummten und brachen psychisch zusammen“. Diese Symptome, die unter anderem auch durch das passive Ausharren und die ständige Todesdrohung in den Schützengräben hervorgerufen wurden, fasste die damalige Militärpsychiatrie unter Bezeichnungen wie Kriegsneurose, Kriegshysterie oder Nervenschock zusammen. Den sogenannten Kriegsneurotikern wurde eine (unbewusste) Flucht aus dem Krieg in die Krankheit unterstellt. In diesem Zusammenhang betonten die Verfechter der psychischen Genese die vermeintliche erbliche Belastung der Betroffenen, ihre innere Abwehr gegen den Kriegsdienst und eine gemütslabile Konstitution. Mit diesem Erklärungsansatz einher ging auch die Annahme, dass der Wille bestimme, wie die Seele auf äußere Anregungen und innere Vorgänge reagierte. Die Behandlung dieser Soldaten entwickelte sich zu einem vordringlichen politisch-medizinischen Problem. Es wurden spezifische Therapiemethoden entwickelt, die heute drastisch anmuten, die damals aber Chancen auf Symptomfreiheit in Aussicht stellten. Bei diesen oft qualvollen therapeutischen Maßnahmen wurde der Patient mit einem noch massiveren Schock als dem Kriegserlebnis konfrontiert, um ihn an die vergleichsweise weniger schmerzhafte Front zurückführen zu können. In frontnahen Lazaretten wurden aber auch Behandlungsformen wie Ruhe, Extrakost und Beruhigungsmittel zur Heilung eingesetzt. (S. 14ff)
Mit dem Ende der Kampfhandlungen waren die psychischen Kriegsfolgen nicht abgeschlossen. Die Weimarer Republik musste sich in dieser Zwischenkriegszeit mit der Anerkennung einer Dienstbeschädigung der seelisch versehrten Veteranen auseinandersetzen. Führende Psychiater, die doch eigentlich für die Patienten da sein sollten, machten die so genannten Kriegsneurotiker sogar für die Niederlage 1918 mitverantwortlich. Sie charakterisierten diese als psychopathologische Persönlichkeiten. Gleichzeitig schoben sie die Verantwortung für das Problem auf die Betroffenen ab. Befördernd hierbei wirkte eine weit verbreitete Lehrmeinung, die die Auffassung vertrat, Krankheitsbilder wie Kriegsneurosen entstünden nicht durch den Krieg, sondern durch das vermeintlich „minderwertige Menschenmaterial“. Viele Ärzte vertraten die sozialdarwinistische Auffassung, dass auf dem Schlachtfeld millionenfach „hochwertige“ Männer gestorben seien, während sich die „Untauglichen“ und „Minderwertigen“ zu Hause in Sicherheit gewogen hätten. Trotzdem erhielten über 600.000 ehemalige Soldaten eine Rente anerkannt, von denen die „nervös Kranken oder vermeintlich Kranken fast die Hälfte stellten“. Die bis dahin schon elenden Verhältnisse in den Anstalten verschlechterten sich weiter. Der Erste Weltkrieg hatte das Lebensrecht von psychisch kranken und geistig behinderten Anstaltspatienten in Frage gestellt, das zu einer Wende in der „Euthanasie“-Diskussion führte. (S. 16 ff)
Schon vor 1930 stellte sich die NSDAP als Fürsprecherin versehrter Veteranen und als Bewahrerin der Heldentaten derer dar, die sich in der Weimarer Republik wirtschaftlich benachteiligt und politisch desillusioniert fühlten. Als Dank des Vaterlandes versprach die Partei, nach ihrer Wahl das Rentensystem zu reformieren. Nach der Machtübernahme rückten aber andere Prioritäten, wie rigorose Sparmaßnahmen, in den Vordergrund. Im Juli 1934 einigten sich die neuen Machthaber auf eine Änderung des „Gesetzes über das Verfahren in Versorgungsfragen“. Jetzt wurden seelische Leiden nicht mehr als Folge von Kriegsdienst anerkannt. Sehr enttäuscht reagierten die versehrten Veteranen, die bereits lange Auseinandersetzungen mit Ärzten und Ämtern um ihre Renten geführt hatten. Wirtschaftlich bedeutete das Gesetz von 1934 für die Mehrheit der versehrten Veteranen einen Verlust. Zahlungen waren genauso eingeschränkt wie in den Jahren vor 1933, und noch immer waren die Veteranen abhängig von Ärzten und Bürokraten, die kaum glauben wollten, dass es 15 Jahre nach Kriegsende immer noch Männer gab, die nicht genesen waren. Diese galten weiterhin als „unmännliche Parasiten“, die die Erinnerung an die Fronterfahrung missbrauchten. Als chronische Hysteriker würden sie im schärfsten Gegensatz zur nationalsozialistischen Weltanschauung stehen und sich als produktive Arbeiter verweigern. (S. 33f)
Besonders hart traf es die Veteranen, die, ausgelöst durch Kriegstraumata, zum Beispiel an Schizophrenie erkrankt waren und eine lange Anstaltsbehandlung nötig hatten. Nach der sich bis dahin gewandelten Meinung der Wissenschaft wurde diese Krankheit jetzt nicht mehr als Folge des Kriegsdienstes anerkannt, sondern als eine Krankheit mit ausschließlich endogenen Ursachen eingestuft. Dies war wiederum nahe an der Ansicht, solche Krankheiten würden ausschließlich durch erbliche Veranlagung hervorgerufen. Viele schizophrene Veteranen hielten sich noch in den dreißiger Jahren ohne nennenswerte finanzielle Vorteile in Heimen auf und waren nicht mehr berechtigt, weiterhin eine Kriegsrente zu beziehen. (S. 56f) Zudem resultierte die Überbelegung in den psychiatrischen Anstalten daraus, dass der NS-Staat ein engmaschiges Netz sozialer Kontrolle knüpfte, durch das Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung kaum hindurchschlüpfen konnten. Mit den Patientenzahlen stiegen die Kosten. Überbelegung, Personalknappheit und Mangelernährung bestimmten den klinischen Alltag. So wurde nach und nach, aber ganz systematisch, den schwächsten, unruhigsten und pflegebedürftigsten Menschen in den Anstalten die Lebensgrundlage entzogen. (S. 62f)
Als ganz „normale“ Anstaltspatienten wurden ab 1939 auch die psychisch kranken Veteranen des Ersten Weltkriegs in der Aktion T4 getötet. Die Verantwortlichen hatten sie nicht vom „Gnadentod“ verschont. Für sie, wie für alle anderen Anstaltsinsassen, entschied das Kriterium der Arbeitsfähigkeit über Leben und Tod. Es kann davon ausgegangen werden, dass insgesamt zwischen 4.000 und 5.000 dieser Soldaten der Euthanasie zum Opfer fielen. „Damit pervertierten die Nationalsozialisten, zumindest was die Behandlung der psychisch kranken Veteranen betrifft, grundsätzlich ihren Anspruch, ehemaligen Kriegsteilnehmern ihren verdienten Platz in der NS-Gesellschaft zu verschaffen. Sie sahen in ihnen keine Kriegshelden, sondern in erster Linie ,minderwertige Geisteskranke’, die als unnütze und unproduktive Esser dahinvegetierten und dem Regime zur Last fielen .“ (S. 73f)
Quelle:
Hrgb: B. Quinkert, P. Rauh, U. Winkler, Krieg und Psychiatrie 1914 – 1950, Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus Band 26, Wallstein Verlag, Göttingen 2010
Text: Anne Schaude, Nürtingen, alle Rechte vorbehalten! Stand: Mai 2014
Bildlizenzen:
Die Fotos auf dieser Unterseite sind unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 3.0 Unported lizenziert, kurz.
Alle Fotos, bei denen Fotograf oder andere Rechteinhaber angegeben sind, und die nicht einer Creative Commons-Lizenz unterliegen oder in public domain sind, sind anders urheberrechtlich geschützt, alle Rechte vorbehalten!.
Daneben gibt es einige Fotos und Abbildungen, die eine Wikimedia Commons-Lizenz haben (Creative Commons Lizenz). Hierfür sind wir nicht die Rechteinhaber. Sie dürfen unter gewissen Bedingungen von jedem verwendet werden. Die bei den Fotos angegebenen Lizenzen werden über diese Links genauer erklärt: eine CC-BY-SA-Lizenz ist z.B. die Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany oder Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Genaueres zur Lizenzierung siehe hier.
 Nürtinger
NS-Opfer
Nürtinger
NS-Opfer